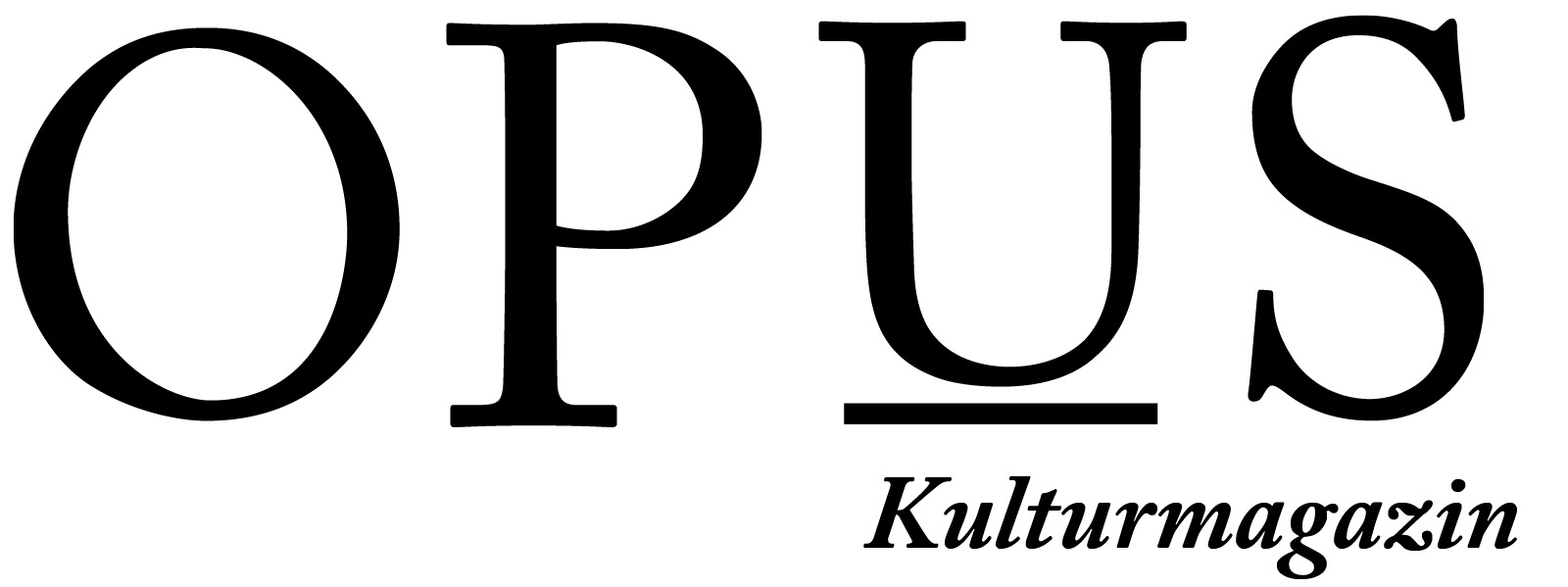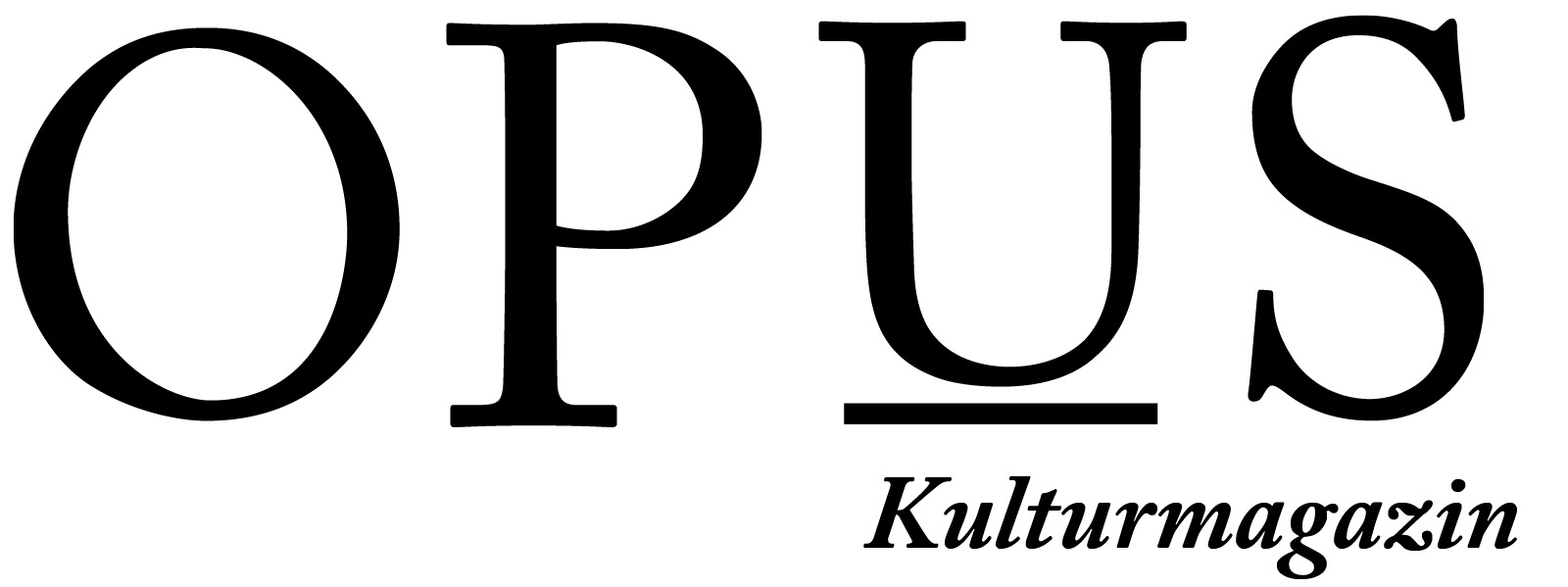Der Speicher des Turms ist nichts für emanzipierte Frauen, Gleichberechtigung muss durchgesetzt werden © Besnik Spahijaj
Man stelle sich folgende Szenerie vor: Mitteleuropa, irgendwann im 19. Jahrhundert, ein herrschaftliches Anwesen, ein Herrenzimmer. Bei Whiskey und Zigarren hat sich hier eine Schar von – ja wer hätte es gedacht – Herren zurückgezogen, um über wichtige Geschäfte zu beraten, um über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Frauen zu debattieren und vor allem auch, um sich mit ihrer Stärke in Physis wie im Geiste zu rühmen. Anders gesagt: Sie geben sich ganz ihrer qua Gott verliehenen gesellschaftlichen Vormachtstellung hin. Jäh unterbrochen werden die wichtigen Unterredungen jener illustren Runde von einem, nun ja, gewissen Tohuwabohu aus Richtung des Dachbodens. Ein Scharren und Poltern, ein Kratzen und Wimmern, ein Kreischen und Lachen. Wer mit der englischen Schauerliteratur des 19. Jahrhunderts vertraut ist, wird wissen, was oder vielmehr wer dort oben sein Unwesen treibt. Nämlich „the madwoman in the attic”*, die verrückte Frau auf dem Dachboden also.
Sie ist kein Einzelfall, nein, sie ist ein Typus gar. Ob in Edgar Allan Poes Kurzgeschichte „Der Untergang des Hauses Usher“, in Charlotte Perkins Gilmans Kurzgeschichte „Die gelbe Tapete“ oder bei der wohl berühmtesten Vertreterin dieses literarischen Motivs, Charlotte Brontёs „Jane Eyre“ – überall werden Frauen, „verrückte“ Frauen, weggesperrt, vor den Augen der Öffentlichkeit auf dem Dachboden versteckt. Nicht nur zum Schutz vor sich selbst, sondern vor allem auch zum Schutz der „natürlichen“ Ordnung. Schließlich sind die Frauen, die man dort wegsperrt, keine normalen Frauen, was in diesem Fall meint: Sie verhalten sich nicht ihrer gesellschaftlichen Rolle entsprechend. Es sind Frauen, die nicht nur nach künstlerischer und intellektueller Teilhabe am Leben streben, sondern auch nach sozialer Gleichheit, Gerechtigkeit. Die Ich-Erzählerin Jane in „Jane Eyre“ etwa wird von der Familie, die sie als zehnjährige Waise aufnimmt, in den „Red Room“ gesperrt, weil sie sich dem Verbot nicht lesen zu dürfen nicht fügen will, dagegen aufbegehrt. Und während die weibliche Ich-Erzählerin in „Die gelbe Tapete“ glaubt, das Schreiben könne ihr in ihrer Depression Linderung verschaffen, erkennt ihr Mann, ein Arzt, dieses Bedürfnis nur als weiteren Ausdruck ihrer vermeintlich geistigen Umnachtung und verordnet ihr vollständige Ruhe in einem Raum unter dem Dach. Bei Madeline in „Der Untergang des Hauses Usher“ lässt sich vermuten, dass ihre geistige Disposition aus der Tatsache rührt, dass ihr Bruder ihr sämtliche geistigen Stimuli und jedweden künstlerischen Ausdruck verbietet. Und im 1966 erschienen Roman „Saragassomeer“, einem Prequel zu „Jane Eyre“, imaginiert die dominikanisch-britische Autorin Jean Rhys den Zustand von Bertha Mason aus „Jane Eyre“ – dem Inbegriff der „madwoman in the attic” – nicht zuletzt auch als aus der ständigen Abhängigkeit von Männern, dem Nicht-Status als Frau in der Gesellschaft herrührend.
Heute, im 21. Jahrhundert, mag uns diese Praxis – Frauen, die aufbegehren, die sich nicht länger der Unterdrückung und Ungleichbehandlung in der Gesellschaft fügen wollen, wegzusperren, sie als verrückt zu erklären – barbarisch erscheinen. Und doch ist sie nicht so weit weg von uns, wie wir gerne glauben möchten. Sie spielt sich nicht mehr in Herrenzimmern und auf Dachböden ab, sondern im öffentlichen Diskurs, auf den Straßen und im Internet. Immer dann, wenn Frauen anklagen, aufbegehren, sich wehren gegen den Status Quo – ein Tohuwabohu machen also – werden zunächst einmal sie selbst in Frage gestellt. Man denke nur an die ab 2017 in den sozialen Netzwerken verbreitete „MeToo-Debatte“, bei der den Frauen ganz schnell Übertreibung, ein Sich-Anstellen, ja Hysterie, unterstellt wurde. Man nennt das übrigens Gaslighting, eine Form psychischer Gewalt, bei der die Wahrnehmung der Realität beim Opfer in Frage gestellt wird. Doch die vermeintlichen „madwomen“ sitzen heute nicht mehr einsam auf Dachböden, sie sind gemeinsam stark, sind draußen auf den Straßen, im Internet und in der Politik. Wir sind viele. Und wir werden weiter ein Tohuwabohu machen.
* Geprägt wurde dieser Begriff von Sandra M. Gilbert und Susan Gubar, die 1979 mit „The Madwoman in the Attic” der feministischen Perspektive auf viktorianische Texte eine ganze Monographie widmeten.
Isabell Schirra